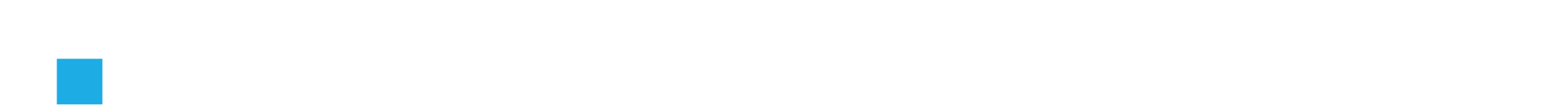Künstliche Belüftung gegen erhöhtes Algenwachstum
Die Johannisbachtalsperre in Bielefeld – besser bekannt unter dem Namen Obersee - stellt ein gutes und aktuelles Beispiel für Smart Environmental IoT dar. Bei der Talsperre handelt es sich um einen künstlich angelegten Stausee mit einer Größe von rund 14,5 Hektar. Als größtes Gewässer Bielefelds dient der See als beliebtes Naherholungsgebiet und ist zudem ein wichtiger Bestandteil der städtischen Umwelt, da dort viele Vogelarten ansässig sind. Trotz seiner Größe misst das Gewässer an seiner tiefsten Stelle nicht mehr als 2,50 Meter. Vor allem in heißen Perioden des Jahres resultiert daraus ein erhöhtes Risiko für Algenwachstum und eine Sauerstoffzehrung mit massiven Algenblüten bis zur Gefahr des Umkippens des Sees. Darunter leiden insbesondere die Fischbestände, für die der Sauerstoff im Wasser eine lebenswichtige Grundlage bildet.
Zur Sicherstellung der notwendigen Lebensbedingungen installierte das Bielefelder Umweltamt bereits in der Vergangenheit eine künstliche Belüftung. Die Prüfung der Wasserqualität ist mit einem entsprechenden Aufwand verbunden, weil dazu eine Seebefahrung mit einem Boot erforderlich ist. Damit die Umweltbedingungen an der Talsperre in Zukunft besser überwacht werden können, hat das Umweltamt ein Smart Environmental IoT-System implementiert. Dabei geht es um eine Smart City Box von Phoenix Contact. An das System können Sensoren mit unterschiedlichen Schnittstellen angekoppelt werden. Für die Messung der Wasserqualität kommt zum Beispiel Sensorik zum Einsatz, um die Trübung und den Sauerstoffgehalte des Wassers zu messen. Darüber hinaus sollen weitere Umweltdaten wie Lufttemperatur, Luftdruck und CO2-Gehalt erfasst werden. Mit diesen Werten können Umweltbehörden und Stadtplaner den Zustand des Sees kontrollieren sowie Probleme wie Algenblüten, Sauerstoffmangel oder andere negative Umwelteinflüsse rechtzeitig identifizieren.
Zur Umsetzung der Monitoring-Lösung mit der Smart City Box wird die Funktechnologie LoRaWAN verwendet. Bei LoRaWAN handelt es sich um eine drahtlose Netzwerktechnologie, die speziell für das IoT und das Aufnehmen von dezentralen Sensoren entwickelt worden ist. Im Gegensatz zu weiteren funkbasierten Systemen zeichnet sich LoRaWAN durch eine sehr große Reichweite bei geringer Stromaufnahme aus. Das ermöglicht die drahtlose Weiterleitung von Sensordaten über zwei Kilometer im Stadtgebiet bis zu 40 Kilometer in ländlichen Umgebungen – und das bei einer langen Lebensdauer der Batterie. Diese Eigenschaften zeigen sich als besonders wichtig, da sich eine Vielzahl von Geräten im und um den Obersee verbauen lässt, ohne das spezifische Infrastruktur notwendig ist. Diese Endgeräte – auch Nodes genannt – übermitteln dann die Sensordaten.
Die LoRaWAN-Technologie nutzt eine bestimmte Art der Modulation, sodass sich Signale über eine große Entfernung sowie bei schwierigen Umgebungen übertragen lassen. Die Signale können durch Gebäude, Bäume oder andere Hindernisse hindurch gesendet werden, weshalb sich der Einsatz der Technologie für Anwendungen zur Überwachung der Umwelt – wie am Obersee – anbietet. Die LoRaWAN-Infrastruktur besteht grundsätzlich aus LoRaWAN-Gateways, welche die Kommunikation zwischen dem Node und dem weiteren Netzwerk ermöglichen. In den Geräten werden die Funktelegramme in TCP/IP-basierte Pakete umgewandelt. Ferner ist ein LoRaWAN-Server erforderlich, der die Datenpakete entgegennimmt, entschlüsselt und die Nutzdaten respektive Messwerte an andere Systeme weitergibt.
Marco Butzkies, Umweltamt Stadt Bielefeld

Autor

MBA Joel Stratemann
Manager Business Development Smart Cities, Vertical Market Management Infrastructure
Phoenix Contact Electronics GmbH, Bad Pyrmont